
Almut Jung
Ihre erfahrene Rechtsanwältin und Fachanwältin für Handels- und Gesellschaftsrecht in München

Gesellschaftsrecht, Personen- und Kapitalgesellschaften
Spezialisierung auf Gesellschaftsrecht und Handelsrecht
Gesellschaftsgründung, Satzungserweiterung, Gesellschafterstreitigkeiten, Geschäftsführer-Haftung bei der GmbH, Anteilsübertragung und Nachfolgeregelung
Mehr erfahren
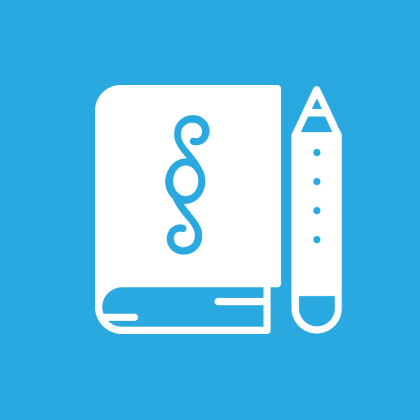
Forderungsmanagement
und Unfallregulierung
Kurze Verfahrenswege,
schnelle Abwicklung
Durchsetzung der Forderungen Ihres Unternehmens
Mahn- und Vollstreckungsbescheid-Verfahren
Mehr erfahren
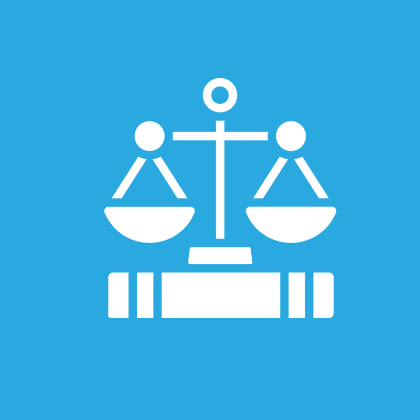
Ordnungswidrigkeiten
und Wirtschaftsstrafrecht
Kompetenz durch Erfahrung
und Vernetzung
Bußgeldverfahren Verkehr sonstigen Ordnungswidrigkeiten (Corona-Verstöße, Verstöße gegen Gewerbeordnung, Verstöße gegen Gaststättengesetz) Steuerhinterziehung, Insolvenzverschleppung
Mehr erfahren


Rechtsanwältin in München
Ihre erfahrene Rechtsanwältin und Fachanwältin für Handels- und Gesellschaftsrecht in München
Zulassung August 2009,
Spezialisierung auf das Handels- und Gesellschaftsrecht seit Anfang 2011,
Personen- und Kapitalgesellschaften,
Gründung bis Liquidation,
Gesellschafterstreit,
Unternehmenskauf,
Unternehmensnachfolge,
bestehendes Netzwerk begleitender Fachbereiche
Mehr erfahren

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin für ihre Erstberatung!
Aktuelles und Grundsätzliches
Bei der Gründung einer Gesellschaft ist zunächst die Wahl der Rechtsform zu treffen. Jede Gesellschaftsform ermöglicht Gestaltungsspielräume, auch steuerliche Überlegungen sollten bei dieser Entscheidung einbezogen werden.
Im Unterschied zu Personengesellschaften können Kapitalgesellschaften auch von einer einzelnen Person gegründet und betrieben werden.
Sobald geklärt ist, welche Rechtsform gewählt wird, ist eine vertragliche Ausgestaltung, die den individuellen Bedürfnissen entspricht, anzuraten.
Im Laufe der Jahre ändern sich die Rahmenbedingungen, die Vorstellungen der Gesellschafter, die wirtschaftliche Lage und ggf. auch die Rechtsprechung betreffend die Wirksamkeit einiger Klauseln. Die Gesellschaftsverträge sind daher nach einem gewissen Zeitablauf zu überprüfen und ggf. anzupassen. So kann eine Abfindungsregelung aufgrund geänderter Gesetzeslage oder angepasster Rechtsprechung zu einem späteren Zeitpunkt unwirksam werden.
Die Vertragsklauseln sollten dabei insbesondere Regelungen zum Ausscheiden, zur Kündigung und zum Ausschluss eines Gesellschafters enthalten. Je konkreter diese gefasst sind, desto einfacher wird in einem später eintretenden Fall das Ausscheiden, die Kündigung oder gar der Ausschluss eines Gesellschafters. So sollten beispielsweise eine klare Abfindungsregelung vereinbart und die Voraussetzungen für einen Ausschluss festgehalten werden.
Der Ausschluss eines unliebsamen Mitgesellschafters ist nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen möglich. Grundsätzlich ist hier das Vorliegen eines wichtigen Grundes erforderlich. Eine gesellschaftsvertragliche Regelung, die diesen Grund konkret ausgestaltet, ist dienlich.
Gesellschafter einer GbR – Änderung der gesetzlichen Lage
Seit 01.01.2024 sind Regelungen für die Gesellschaft bürgerlichen Rechts in das Bürgerliche Gesetzbuch aufgenommen worden. Grundlage ist das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG).
In § 705 II und III BGB werden die rechtsfähige und die nicht rechtsfähige Gesellschaft definiert. Damit wird zwischen Außen- und Innengesellschaft unterschieden. Folglich gibt es drei Formen der GbR: die nicht rechtsfähige, die rechtsfähige, aber nicht registrierte und schließlich die rechtsfähige und registrierte GbR.
Wichtigste Neuerung ist die Anmeldung der GbR zum Gesellschaftsregister, § 707 BGB. Die Folge ist eine deutliche Aufwertung der Gesellschaftsform der GbR, deren Name, Sitz und Gesellschafter nun im Register einsehbar sind. Dadurch können beispielsweise Änderungen bei den Gesellschaftern nachvollzogen werden.
Das Gesellschaftsregister ist ein öffentliches Register, welches vom Handelsregister unabhängig ist.
Das MoPeG hat gesetzliche Grundlagen zu einigen Teilbereichen geschaffen, wie etwa bei der Auflösung (Anmeldung, § 733 BGB, Auflösungsgründe, § 729 BGB, Fortsetzung der Gesellschaft, § 734 BGB).
Eine Regelung bei Ausscheiden des vorletzten Gesellschafters und mithin zur Einpersonengesellschaft wurde getroffen, § 712 a BGB.
Zu beachten ist auch die inhaltliche Veränderung hinsichtlich der Beteiligung am Gewinn und Verlust: die Gewinnverteilung nach Köpfen wird abgeschafft, § 709 III BGB.
Das MoPeG hält an der Einstimmigkeit der Gesellschafterbeschlüsse (§ 714 BGB) fest, das Beschlussmängelrecht basiert auf dem Feststellungsmodell. Die gesellschaftsvertraglichen Regelungen sind daher zu prüfen und gegebenenfalls zu ergänzen.
§ 715 BGB regelt die Geschäftsführungsbefugnis dahingehend, dass alle Gesellschafter zur Führung der Geschäfte der Gesellschaft berechtigt und verpflichtet sind.
Die Regelungen im BGB erfordern die genaue Prüfung der vorliegenden Gesellschaftsverträge, eventuell sind Anpassungen erforderlich.
Gerne stehe ich Ihnen diesbezüglich beratend zur Seite.
Die Haftung des GmbH-Geschäftsführers
Dem Geschäftsführer einer GmbH obliegt es, vielfache Sorgfaltspflichten zu beachten. Zum einem ist dies die Legalitätspflicht. Der Geschäftsführer ist dafür verantwortlich, dass die Gesellschaft die Rechtsvorschriften beachtet. Wesentlich sind dabei die Einhaltung der buchführungs- bzw. bilanz- und steuerrechtlichen Pflichten und die Beachtung der Bestimmungen des Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts (Stichwort: Insolvenzantragspflicht).
Daneben bedeutet die Vermögensbetreuungspflicht eine Haftung des Geschäftsführers, sofern Gelder der Gesellschaft unter Missachtung des Grundsatzes des Erhalts des Stammkapitals an die Gesellschafter ausgekehrt werden.
Eine weitere Pflicht für den Geschäftsführer ist die Loyalitäts- und Treuepflicht. Der Geschäftsführer ist gegenüber der Gesellschaft zur Loyalität verpflichtet. Vor allem beim Abschluss von Rechtsgeschäften zwischen der Gesellschaft und Dritten, etwa bei Geschäften, die beinhalten, sich Provisionen versprechen zu lassen.
Die Einhaltung der Kompetenzordnung der Gesellschaft zählt auch zu den Pflichten. Die gesetzlich geregelten Zuständigkeiten sind zu beachten, der Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft nach außen, die Entscheidungen über wesentliche gesellschaftsrechtliche Angelegenheiten (Sitz, Zweck, gesellschaftsvertragliche Änderung u.a.) trifft jedoch die Gesellschafterversammlung. Die Vertretungsbefugnis des Geschäftsführers ist im Außenverhältnis unbeschränkt. Im Innenverhältnis sind jedoch die Beschränkungen des Gesellschafts- und Anstellungsvertrages sowie die Gesellschafterbeschlüsse einzuhalten.
Der Geschäftsführer ist zwar grundsätzlich frei, Entscheidungen zu treffen, er ist aber verpflichtet, diese in einer angemessenen Informationsgrundlage zu entscheiden. Er kann sich nicht ausschließlich bei der Ermessenausübung auf das Urteil eines Dritten verlassen (Beispiel: Beauftragung eines Steuerberaters). Der unternehmerische Ermessungsspielraum ist überschritten, wenn die Mittel der Gesellschaft für gesellschaftsfremde oder eigennützige Zwecke verwendet werden.
Ein Streit zwischen den Gesellschaftern kann etwa dadurch entstehen, dass ein Beschluss gefasst wird, welcher im Nachgang von einem oder mehreren Gesellschaftern im Wege der Anfechtungs- oder Nichtigkeitsklage angegriffen wird. Hier kann bereits im Vorfeld Konfliktpotenzial durch die anwaltliche Betreuung entschärft werden.
Von erheblicher Bedeutung sind die gesellschaftsvertraglichen Regelungen. Je weniger konkret geregelt ist, desto langwieriger wird der Gesellschafterstreit. Viele Konflikte lassen sich dadurch vermeiden, dass konkrete Ausführungen im Gesellschaftsvertrag formuliert werden. Klare und eindeutige Vertragsklauseln führen dazu, die Konfliktsituation zu entschärfen.
Gesellschafterstreit bedeutet jedoch auch die Entziehung der Geschäftsführung oder die sofortige Abberufung von Gesellschaftergeschäftsführern. Vor allem bei einer fehlenden Mehrheit hinsichtlich einer Beschlussfassung gilt es zu ergründen, welche Möglichkeiten der jeweilige Gesellschafter gegen den oder die Mitgesellschafter hat. Gerade in der Zwei-Personengesellschaft sind regelmäßig aufkommende Streitfragen zu klären.
Stets kann und sollte im vorgerichtlichen Verfahren eine Einigung zwischen den Gesellschaftern angestrebt werden, da die Gerichtsverfahren nicht nur eine lange Verfahrensdauer, sondern häufig eine Ungewissheit hinsichtlich des Ausgangs bedeuten. Die Auslegung einer vertraglichen Klausel kann zugunsten oder zuungunsten des betroffenen Gesellschafters ausfallen. Ein richtig oder falsch gibt es hier nicht, es handelt sich um eine juristische Wertung, die durch den Anwalt zwar so gut als möglich vorgetragen werden kann. Das Gericht bleibt jedoch frei, eine eigene Bewertung vornehmen.
Im Rahmen der Verhandlung und des gesellschafterlichen Miteinanders ist die Treuepflicht, welche gesteigert in der Personengesellschaft gilt, zu beachten.
Der Ausschluss eines unliebsamen Mitgesellschafters ist nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen möglich. Grundsätzlich ist hier das Vorliegen eines wichtigen Grundes erforderlich. Eine gesellschaftsvertragliche Regelung, die diesen Grund konkret ausgestaltet, ist unerlässlich.
Bei Ausschluss oder eigener Kündigung eines Gesellschafters aus einer Kapital- oder Personengesellschaft entsteht ein Abfindungsanspruch. Die Abfindungshöhe basiert auf dem Ertrag der Gesellschaft, dem Unternehmenswert und den Firmenwerten wie z.B. Grundstücken.
Im Rahmen der ersten außergerichtlichen Verhandlungen ist es notwendig, selbst ein fundiertes Zahlenwerk samt Darlegung des Berechnungsweges und der gesetzlichen Grundlagen zur Verfügung zu stellen, um eine zeitnahe Einigung mit der Gegenseite zu erreichen.
Für eine präzise Bewertung sind außergerichtliche Verhandlungen und möglicherweise ein Gutachten eines Wirtschaftsprüfers erforderlich.
Neben der grundsätzlichen Bemessung der Höhe der Abfindung sind zudem steuerliche Aspekte bei der Abfindungsbewertung zu berücksichtigen, wobei die Zusammenarbeit mit einem steuerlichen Berater essentiell ist.
Oftmals werden im Bereich der Abfindung alleine die Zahlen an sich beachtet, nicht die steuerlichen Folgen. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund einer ratenweisen Zahlung der Abfindung, was gerade bei Familienunternehmen die Regel schon aufgrund der Gesellschaftsverträge ist.
Zu prüfen ist daneben, ob der Gesellschaftsvertrag Regelungen zur Bemessung der Abfindung vorsieht und ob diese Regelungen wirksam sind. Einige Klauseln schränken das Recht eines Gesellschafters, aus der Gesellschaft auszuscheiden, so stark ein, indem eine Abfindungsregelung getroffen wird, die den Gesellschafter klar benachteiligt.
Für eine erste Einschätzung der Sach- und Rechtslage sowie des Abfindungsanspruchs wird angeboten, Kontakt aufzunehmen.
Unternehmenskauf
Der Verkäufer eines Unternehmens sieht sich aufgrund fehlender Nachfolge im Familienunternehmen für veranlasst, sein Unternehmen zu veräußern. Ein Unternehmens(teil)verkauf kommt auch dann in Betracht, wenn Teile der Geschäftsfelder nicht mehr fortgeführt werden sollen.
Ein Unternehmensverkauf sollte langfristig geplant sein und gut vorbereitet werden. Zunächst ist die Frage zu klären, ob das Unternehmen in seiner Gesamtheit (share deal) oder einzelne Wirtschaftsgüter (asset deal) verkauft werden sollen.
Bei einem share deal werden die Geschäftsanteile vollständig erworben mit der Folge aller daran anhaftenden Chancen und Risiken. Dabei sind vor allem die Vorschriften der Kapitalerhaltung zu beachten. Haftungsrisiken können grundsätzlich nur im Innenverhältnis auf den Verkäufer verlagert werden.
Bei einem asset deal ist es erforderlich, die zu erwerbenden Wirtschaftsgüter genau zu bezeichnen. Dies erfolgt in der Regel durch eine Inventarliste, welche den Kaufvertrag als Anlage beigefügt wird.
Nach dieser Entscheidung erfolgt die Unternehmensbewertung. Naturgemäß strebt der Verkäufer einen hohen Unternehmenswert, der Käufer hingegen einen niedrigen Unternehmenswert an. Im Rahmen der Verhandlungen gilt es, die gegenseitigen Positionen anhand fundierter Unternehmensbewertung anzunähern und dabei die steuerlichen Aspekte in Betracht zu ziehen.
Im daran anschließenden Schritt kann der Kaufpreis als fester Betrag vereinbart werden. Es ist jedoch auch möglich, einen vorläufigen Kaufpreis zu einem bestimmten Stichtag zu vereinbaren und diesen zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund der Veränderung des bilanziellen Eigenkapitals anzupassen.
Die Verhandlungsphase wird durch einen ersten Vertragsentwurf eingeleitet. Zu beachten sind insbesondere die von der den Vertragsentwurf vorlegenden Seite gestellten allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche dann einer Inhaltskontrolle zu unterziehen sind. Das Vertragswerk ist anhand der im jeweiligen Einzelfall vorliegenden Interessen auszugestalten und auszuarbeiten.
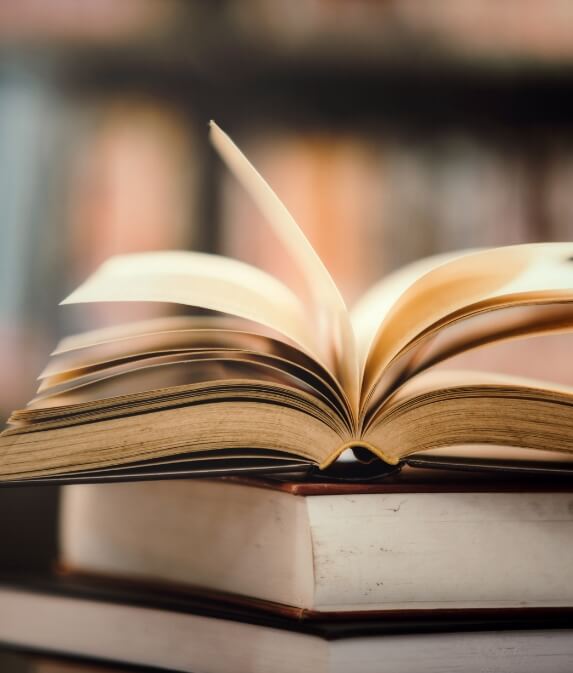
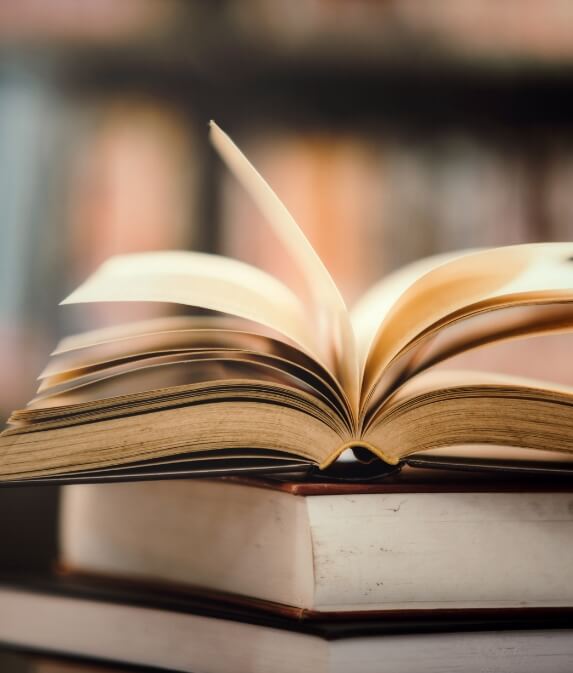
Jetzt Termin für eine Erstberatung vereinbaren
Adresse
Blumenstraße 1
80331 München
Kontakt
Telefon: 089 33 03 50 53
E-Mail: kanzlei@rajung.com
Weitere Links
© 2025 Rechtsanwältin Almut Jung
